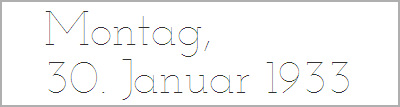Warum die Persönlichkeitsrechte des Co-Piloten des Fluges 9525 die Menschen und die Presse spalten
Ich hatte gerade einen Medienbeitrag in meinem privaten Facebook-Profil geteilt. Er zeigte das Foto sowie den vollen Namen des Co-Piloten der abgestürzten Airbus-Maschine. Die Auswertung des Stimmrekorders ergab, dass der Co-Pilot absichtlich den Sinkflug eingeleitet hat, also die Maschine absichtlich hat abstürzen lassen - als der Kapitän kurz das Cockpit verlassen hatte. Der Co-Pilot lies ihn nicht mehr ins Cockpit. Diese Beweislage ist erdrückend.
Folglich gibt es nun ein riesiges berechtiges Interesse an dem verantwortlichen Co-Piloten. Wer war der Mann? Man möchte alles über ihn wissen. Zurecht. Die Gesellschaft und die Hinterbliebenen haben ein Recht zu erfahren, was diesen Menschen angetrieben haben könnte. Der Co-Pilot ist bereits durch die Faktenlage zu einer absoluten Person der Zeitgeschichte geworden (wobei sich hier schon Geister streiten werden). Vielleicht gibt es noch allerletzte Zweifel, aber die Fakten und Schlussfolgerungen sprechen eine ziemlich eindeutige Sprache. Die Presse wird sich also zu Recht mit dem Leben des Co-Piloten auseinander setzen. Die Frage scheint nur noch zu sein: wann?
Nachdem ich den Beitrag geteilt hatte, war ich überrascht, was für eine heftige, harsche Reaktion das erzeugte. Es ging um Persönlichkeitsrechte und die Unschuldsvermutung. Ich habe den Beitrag wieder aus meinem Profil gelöscht. Vorerst.
Ich verstehe die Einwände. Überstürzen wir nichts. Aber machen wir uns gefasst. Gerade lese ich, dass sich N24 auf Twitter entschuldigt hat: "Es tut uns leid, dass wir das Haus des #Germanwings-Co-Piloten im TV gezeigt haben. Wir werden in Zukunft auf diese Bilder verzichten."
Der mediale Umgang mit dem Co-Piloten wird mit Sicherheit als ein ganz heikler Fall in die Geschichte des Presserechts beziehungsweise der Medienethik eingehen. Weil er so heikel ist. Weil die Faktenlage so erdrückend ist. Weil die Tragödie so groß ist. Die Frage scheint nur zu sein: Wann darf die Presse wie ausführlich über den Co-Piloten, der offenbar der Täter ist, berichten?
Folglich gibt es nun ein riesiges berechtiges Interesse an dem verantwortlichen Co-Piloten. Wer war der Mann? Man möchte alles über ihn wissen. Zurecht. Die Gesellschaft und die Hinterbliebenen haben ein Recht zu erfahren, was diesen Menschen angetrieben haben könnte. Der Co-Pilot ist bereits durch die Faktenlage zu einer absoluten Person der Zeitgeschichte geworden (wobei sich hier schon Geister streiten werden). Vielleicht gibt es noch allerletzte Zweifel, aber die Fakten und Schlussfolgerungen sprechen eine ziemlich eindeutige Sprache. Die Presse wird sich also zu Recht mit dem Leben des Co-Piloten auseinander setzen. Die Frage scheint nur noch zu sein: wann?
Nachdem ich den Beitrag geteilt hatte, war ich überrascht, was für eine heftige, harsche Reaktion das erzeugte. Es ging um Persönlichkeitsrechte und die Unschuldsvermutung. Ich habe den Beitrag wieder aus meinem Profil gelöscht. Vorerst.
Ich verstehe die Einwände. Überstürzen wir nichts. Aber machen wir uns gefasst. Gerade lese ich, dass sich N24 auf Twitter entschuldigt hat: "Es tut uns leid, dass wir das Haus des #Germanwings-Co-Piloten im TV gezeigt haben. Wir werden in Zukunft auf diese Bilder verzichten."
Der mediale Umgang mit dem Co-Piloten wird mit Sicherheit als ein ganz heikler Fall in die Geschichte des Presserechts beziehungsweise der Medienethik eingehen. Weil er so heikel ist. Weil die Faktenlage so erdrückend ist. Weil die Tragödie so groß ist. Die Frage scheint nur zu sein: Wann darf die Presse wie ausführlich über den Co-Piloten, der offenbar der Täter ist, berichten?
7an - 2015-03-26 15:28